Sollen Steinkauz, Wiedehopf und Ziegenmelker in der Schweiz langfristig Überlebenschancen haben, sind sie auf Unterstützung angewiesen. Alle drei sind deshalb Prioritätsarten für die Artenförderung auf nationaler und kantonaler Ebene. Ihre Bestände sind auch im Tessin sehr klein; ohne Förderungsmassnahmen drohen sie ganz zu erlöschen. 2009 lancierten Ficedula – die Landesorganisation von BirdLife Schweiz in der italienischsprachigen Schweiz – und BirdLife Schweiz deshalb ein Projekt zur Förderung der drei Vogelarten im Tessin (siehe auch Ornis 5/2009).
Der Steinkauz und der Wiedehopf leben in traditionell bewirtschaftetem Landwirtschaftsgebiet. Ihre Förderung bedingt deshalb eine enge Zusammenarbeit mit den Landwirten und den Winzern. Ziegenmelker – und zu einem gewissen Grad auch Wiedehopf – sind hingegen auf lichten Wald angewiesen. Für die Förderung dieser beiden Arten muss demnach nach Synergien mit der Forstwirtschaft gesucht werden. Besonders wichtig ist es, die Förster für die Bedeutung der offenen Baumbestände zu sensibilisieren. Im Tessiner Artenförderungsprojekt ging es zunächst einmal darum, das lückenhafte Wissen über die Verbreitung und die Ökologie der drei Arten im Kanton zu aktualisieren und zu ergänzen. Zudem galt es, rasch Massnahmen zu entwickeln, um die Populationen der drei Arten zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Bestände wachsen. Parallel dazu wurden in Zusammenarbeit mit diversen Partnern bereits Fördermassnahmen gestartet: mit den kantonalen Ämtern für Forstwesen, Naturschutz und Landwirtschaft sowie mit den Organisationen von Bauern, Winzern und Förstern. Nach mehreren Jahren intensiver Arbeit zeigen sich nun erste Erfolge.
Steinkauz: spezielle Nistkästen aus Beton
Anfang der 2000er-Jahre lebten im Tessin nur noch in der Magadino-Ebene Steinkäuze. Seit Beginn des Förderprojekts ist es gelungen, die Bestände von 9 Brutpaaren im Jahr 2009 auf 14 im Jahr 2016 zu erhöhen. Diese Zunahme ist mit Sicherheit das Ergebnis der Massnahmen, die zugunsten des Steinkauzes umgesetzt wurden. Ein Schlüsselfaktor dürfte dabei ein neuer Nistkastentyp sein: Der Kasten besteht nicht aus Holz wie in anderen Regionen der Schweiz und in Zentraleuropa, sondern aus Beton. Denn im Gegensatz zu den Steinkäuzen nördlich der Alpen, die in Baumhöhlen brüten, ist die kleine Eule im Tessin ans Brüten in Mauernischen in Rustici gewöhnt.

Im Tessin brütet der Steinkauz gerne in solchen Rustici. © Roberto Lardelli
Tatsächlich zeigten unsere Tests 2010, dass der neue Betonnistkasten den Steinkäuzen im Tessin besonders zusagt: Er wurde sofort angenommen. Inzwischen montierten wir fast 50 dieser Nistkästen. Die Erfolge dürfen sich sehen lassen: 2012 schlüpften 36 Küken, eine Rekordzahl! 2013 brütete dann eine Rekordzahl an Paaren. Und 2013, wie dann auch 2014 und 2015, brütete zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder ein Steinkauzpaar ausserhalb der Magadino-Ebene. Dies hat wichtige Auswirkungen auf die Zukunft der Art im Tessin.
Im Rahmen des Projekts gelang es zudem, fünf vom Steinkauz genutzte Rustici zu erhalten, fünf Brutnischen in Rustici zu schützen und 100 Pfosten als Sitzwarten zu installieren, die dem Steinkauz die Jagd erleichtern. Parallel erforschten wir die Ökologie und den Aktionsradius von zwei Paaren und untersuchten deren Gewölle. Die erhobenen Daten dienen uns als Grundlage für die Entwicklung wirkungsvoller Massnahmen zur Erhaltung und Erhöhung des Steinkauzbestandes.
Wiedehopf: stabiler Bestand
Im Tessin ist der Bestand des Wiedehopfs, trotz einiger jährlicher Schwankungen, stabil und besteht aus ungefähr zwanzig Brutpaaren. Dies ist unter anderem dem Artenförderungsprojekt von Ficedula und BirdLife Schweiz zu verdanken. Die für die Förderung prioritären Gebiete sind die Magadino-Ebene samt umliegender Flächen, die Riviera und das Bleniotal. Hier brüten die meisten Paare. Weiter gibt es in der Region von Lugano und im Mendrisiotto verstreute Einzelreviere.

Der Wiedehopfbestand im Tessin ist mehr oder weniger konstant. © Michael Gerber
Im Rahmen des Artenförderungsprojekts konnten wir in der Magadino-Ebene, in der Riviera und im Mendrisiotto Hochstamm-Obstgärten, neue Obstbaumreihen, Hecken und Kleinstrukturen sowie gebüschreiche Zonen mit über 600 Bäumen und Sträuchern anlegen. In der Magadino-Ebene und in der Riviera kamen Stein- und Asthaufen hinzu.

Diese Obstbaumpflanzung in der Magadino-Ebene gelang dank der Zusammenarbeit mit der Gruppe «OrtoBio» aus Gudo. Sie soll dem Wiedehopf zugute kommen. © Chiara Scandolara
Zudem wurden mehr als 100 Nistkästen installiert und betreut – hauptsächlich in der Magadino-Ebene, um den Wiedehopfen eine Alternative zu den raren natürlichen Höhlen anzubieten. Einzelne Kästen wurden von den Wiedehopfen genutzt, doch profitierten auch andere national prioritäre Vogelarten wie der Wendehals und der Gartenrotschwanz von den Brutgelegenheiten.
Die praktische Naturschutzarbeit ermöglichte einen engen Kontakt mit den Landwirten und Winzern. Daraus entstand ein grosses Netzwerk von mehr als 400 Partnern. Weiter organisierten die Projektverantwortlichen einen Kurs, an welchem die Teilnehmenden lernten, wie eine Trockenmauer mit Nistnischen gebaut wird, die sich für den Wiedehopf eignen. Einige Kursteilnehmer schritten anschliessend gleich zur Tat und bauten entsprechende Mauern mit Nisthilfen für den Wiedehopf. In einer hat bereits eine Brut stattgefunden. BirdLife Schweiz bietet zum Thema ein Merkblatt an (Bestellung: S. 47).
Wie das Steinkauzprojekt war auch jenes für den Wiedehopf Startpunkt für eine äusserst positive Zusammenarbeit mit vielen Akteuren. In diesem Fall waren es unter anderem das kantonale Landwirtschaftsamt, die Tessiner Winzervereinigung, der Bauernverband und die kantonale Landwirtschaftsschule Mezzana. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Teil der Förderung von Wiedehopf, Steinkauz und anderen prioritären Arten, die im Landwirtschaftsgebiet vorkommen.
Ziegenmelker: auf Nachtfalter angewiesen
Massnahmen für den Ziegenmelker sind aufwändig und oft schwierig umzusetzen. Diese Art braucht lichte und sonnige Wälder, Waldränder mit Büschen sowie sandige und steinige Böden. Die Häufigkeit von nachtaktiven Fluginsekten, insbesondere Nachtfaltern, spielt eine wichtige Rolle. Umfangreiche und teure waldbauliche Massnahmen sind nötig, um den Wald auf einer grossen Fläche aufzulichten. Die Hauptstrategie für die Förderung des Ziegenmelkers im Tessin besteht deshalb darin, die Förster dafür zu gewinnen, mehr Licht in den Wald zu bringen. Davon profitieren nicht nur der Ziegenmelker, sondern auch viele andere Arten. Da, wo sowieso Holzschlag betrieben wird, gilt es, diesen auf die Bedürfnisse des Ziegenmelkers auszurichten.

Der Ziegenmelker ist bestens getarnt. Seine Anwesenheit verrät er nur durch den schnurrenden Gesang. © Günther Bachmeier
Während des Projekts entwickelten wir eine enge Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Wald. Mehrere lokale Treffen und Beratungen wurden durchgeführt. 2013 organisierten wir einen Weiterbildungstag, an welchem 58 Forstingenieure und Forstverantwortliche aus dem ganzen Tessin teilnahmen. An diesem Anlass konnten wir die prioritären Waldarten und die Massnahmen zur Förderung des Ziegenmelkers vorstellen. Ergänzt wurde der Weiterbildungstag mit einem praktischen Teil im Feld, wo ein geschlossener Birken-Kastanienwald auf etwa 25 Bäume pro Hektare ausgelichtet wurde. Zudem konnten rund zehn Sitzwarten eingerichtet werden.
Was klein angefangen hat, hat sich inzwischen zu einem umfassenden Artenförderungsprojekt entwickelt. In den letzten Jahren führten wir Beratungen für sechs Waldauslichtungsprojekte durch. In einer Kastanienselve profitierte der Gartenrotschwanz von den Massnahmen, andernorts Zippammer, Zilpzalp oder Mönchsgrasmücke. Äusserst erfreulich: Es wurde auch ein neues Ziegenmelker-Revier gefunden! Dies ist das erste Mal in der Schweiz, dass sich ein Ziegenmelker an einem Ort ansiedelt, wo Massnahmen für die Art ergriffen wurden. In allen anderen Projekten hat der Ziegenmelker die extra für ihn angelegten Waldlichtungen bisher nicht angenommen.

In diesem ausgelichteten Waldstück im Centovalli hat sich der Ziegenmelker angesiedelt. © Chiara Scandolara
Schlechtwetterphasen wie jene von 2013 können sich sehr negativ auf Vogelbestände auswirken. So lag der Ziegenmelker-Bestand 2012 noch auf einer Rekordhöhe von 21 Paaren. 2013 nahm er dramatisch ab; der kalte Frühling hatte zu einem Mangel an Nachtfaltern geführt. Im Frühling 2014 waren die Witterungsbedingungen weitgehend normal, und der Ziegenmelkerbestand stieg wieder etwas an. Nur wenn die Bestände gross genug sind, kann der Ziegenmelker Extremereignisse verkraften und langfristig überleben.
Das ganze Kantonsgebiet einbeziehen
Nach sieben arbeitsintensiven Jahren können wir mit Stolz sagen, dass das Projekt auf gutem Weg ist. Mit dem Ziegenmelker ging es bis zum regenreichen Frühling 2013 aufwärts, und der Wiedehopf weist stabile Bestände auf. Die Zunahme des Steinkauzes ist spektakulär; ohne das Projekt wäre sie nicht möglich gewesen.
Um die positive Entwicklung und das Überleben der drei Vogelarten langfristig zu sichern, müssen die Massnahmen weitergeführt und vor allem auf das ganze Kantonsgebiet ausgedehnt werden. Diese zweite Projektphase, die bis 2018 dauern wird, setzt hauptsächlich auf konkrete Artenförderungsmassnahmen. Diese stellen das wichtigste Element für die Erhaltung und Zunahme der Bestände dar.
Um überhaupt geeignete Massnahmen ergreifen zu können, sind die Sensibilisierung und die Zusammenarbeit mit Landwirten und Winzern ausschlaggebend. Doch auch die Kooperation in Vernetzungsprojekten und die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Wald und anderen Partnern sind absolut zentral. Ein wichtiger Teil ist und bleibt die Öffentlichkeitsarbeit. Bis jetzt hielten wir rund 25 Vorträge in verschiedenen Kantonsteilen und nahmen regelmässig an Veranstaltungen mit Bauern teil. Mehrere Radiosendungen, Interviews und Zeitungsartikel sind bisher erschienen. Mit der Tessiner Bauernzeitschrift «Agricoltore Ticinese» besteht eine ständige Zusammenarbeit.
Das Tessiner Artenförderungsprojekt von Ficedula und BirdLife Schweiz ist inzwischen so gut bekannt, dass sich Interessierte direkt bei uns melden, um eine Beratung zu erhalten. Diesen Schwung gilt es die nächsten Jahre auszunützen, damit Steinkauz, Wiedehopf und Ziegenmelker, aber auch weitere Arten wie Zwergohreule und Wendehals auch langfristig im Tessin überleben
können!

Chiara Scandolara (ganz links) mit Lina und Maurizio Cattaneo. Die beiden Biobauern von Lodrino (Riviera) machen bei den Tessiner Artenförderungsprojekten mit. © Roberto Lardelli
Dr. Chiara Scandolara und Roberto Lardelli sind für BirdLife Schweiz für die Artenförderungsprojekte im Tessin verantwortlich. Roberto ist Präsident, Chiara ist Vorstandsmitglied von Ficedula.












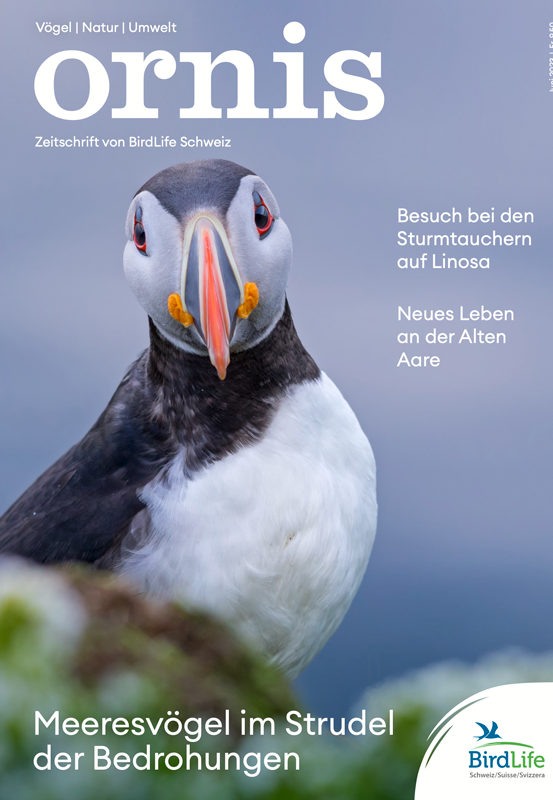
Schritt für Schritt voran