Hochstamm-Obstgärten prägen die Kulturlandschaft um Horgen und Wädenswil (ZH). Während Jahrhunderten wurden solche Gärten rund um die Siedlungen gepflanzt und lieferten nicht nur Tafel- und Brandobst, sondern boten auch wertvolle, reich strukturierte Lebensräume für viele Tier- und Pflanzen. Heute sind sie auch ein wichtiges Kulturgut und Naherholungsgebiet.
Allerdings gerieten diese Lebensräume durch die Intensivierung der Landwirtschaft immer stärker unter Druck. Moderne Agrarpraktiken und Effizienzsteigerung stehen oft im Konflikt mit einer kleinräumigen, biodiversitätsfördernden Landwirtschaft. Um die Landschaft intensiver und mit grösseren Maschinen bewirtschaften zu können, wurden viele Bäume gefällt oder man stellte den Obstbau auf weniger aufwändige Niederstammkulturen um. Auch die Nährstoffeinträge nahmen stark zu. So sind zahlreiche Tier- und Pflanzenarten aus dem Lebensraum verdrängt worden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt sich BirdLife Schweiz zusammen mit BirdLife Zürich sowie den lokalen BirdLife-Naturschutzvereinen Natur Horgen und Naturschutz Wädenswil seit 2007 dafür ein, die Hochstamm-Obstgärten in dieser Region wiederzubeleben und die ehemals hohe Artenvielfalt wiederherzustellen.
Orchideen und Falter
Seither ist durch verschiedenste Aufwertungs- und Pflegemassnahmen um Horgen und Wädenswil ein für Flora und Fauna attraktives und strukturreiches Mosaik an Lebensräumen entstanden. 42 Magerwiesen und Ruderalflächen, 29 Reptilienstrukturen, zahlreiche Jungbäume und mehrere hundert Meter Hecken, viele Kleinstrukturen sowie Nisthilfen bereichern heute die Obstgärten. Viele Tiere und Pflanzen konnten gefördert oder wieder im Gebiet etabliert werden.
So wurde erstmals seit langer Zeit wieder mehrere Jahre hintereinander ein Gartenrotschwanz-Revier nachgewiesen. Auf den neu geschaffenen, mageren Standorten blühen heute zahlreiche seltene Pflanzenarten wie der Kreuzblättrige Enzian (Gentiana cruciata), der Durchwachsene Bitterling (Blackstonia perfoliata) und zahlreiche Orchideen. Darüber hinaus haben sich Schmetterlinge wie der Kurzschwänzige Bläuling (Cupido argiades) und der Malvendickkopffalter (Carcharodus alceae) ebenfalls im Projektgebiet etabliert.
Die Pflanzenzusammensetzung auf Ruderalflächen ändert sich von Jahr zu Jahr. Hier dominieren der Natterkopf und Mohn. © Livia Bieder
Im Wolfbühl wurde auf einer Fläche der Oberboden abgetragen und die Hälfte des Rohbodens mit Wandkies abgedeckt. So entstand neben einer Magerwiese zusätzlich eine Ruderalfläche. © Livia Bieder
Das Projekt stiess aber auch auf Herausforderungen, etwa bei der Erschaffung von mageren Standorten. Da die Region Horgen-Wädenswil sehr niederschlagsreich ist und die Böden schwer sind, wird viel Stickstoff eingetragen und gut gespeichert. Dies führt zu fruchtbaren Ackerböden, aber auch eintönigen Wiesen. In der Folge nehmen nährstoffliebende Gräser stark zu und verdrängen konkurrenzschwache Blütenpflanzen, die für viele Insekten wichtig sind. Aufgrund dieser schwierigen Ausgangslage trugen wir stellenweise nährstoffreichen Oberboden ab, damit sich wieder abwechslungsreiche, magere Wiesen entwickeln konnten. Unsere kontinuierlich und sorgfältig geplanten Pflegemassnahmen auf den neu geschaffenen Magerflächen zeigen beachtliche Erfolge.
Um möglichst viele Tierarten zu fördern, bauten wir zusätzlich Ast- und Steinhaufen für Reptilien und andere Kleintiere. Einige Wiesen säumten wir mit Hecken aus wertvollen einheimischen Sträuchern. Für Vögel und Fledermäuse hängten wir Nisthilfen in die Hochstamm-Obstbäume. Mit den Jahren entstand so ein grossflächiges Netz aus vielen kleinen und mittelgrossen Lebensräumen.

Der Malvendickkopffalter profitierte vom BirdLife-Projekt. © Goran Dušej/Swiss Butterfly Monitoring
Lokales Engagement
Das Projekt zeigt, dass auch intensiv bewirtschaftete Landwirtschaftszonen aufgewertet werden können und ein Mosaik aus mehreren kleinen Strukturen und Flächen die Landschaft und die Artenvielfalt bereichert. Die enge Zusammenarbeit und das Engagement der lokalen Bevölkerung sowie die langjährige Präsenz im Projektgebiet sind dabei entscheidend für die positiven Ergebnisse. Auch wenn zuerst viele Obstgartenbewirtschafterinnen und -bewirtschafter dem Projekt und den Umsetzungsmassnahmen skeptisch gegenüberstanden: Mit der Zeit und dank der guten lokalen Verankerung konnten sie für das Projekt gewonnen werden. Sehr erfreulich ist, dass auch immer wieder neue, zum Teil junge Landwirtinnen und Landwirte die Wichtigkeit der Aufwertungsmassnahmen erkennen und einen Beitrag für die Erhaltung der Artenvielfalt leisten möchten.
Der Grossteil der Aufwertungsarbeiten ist beendet, nun gilt es, das Erreichte langfristig zu sichern und die Fortschritte weiterzuentwickeln. Um dies zu gewährleisten und das bestehende Netzwerk an Massnahmen zu verdichten, wird das Obstgartenprojekt in das regionale Projekt Naturnetz Zimmerberg überführt. Dieses fördert die regionale Biodiversität, die Vernetzung von Lebensräumen sowie die Landschafts- und Erholungsqualitäten. Der Aufbau dieses Projektes ist erfreulich und erfolgversprechend, weil die Landwirte und Gemeinden eng in die Entstehung integriert sind und das Projekt so von einer breiten Öffentlichkeit getragen wird.
Livia Bieder ist Biologin und Koordinatorin des Obstgartenprojekts Horgen-Wädenswil für BirdLife Schweiz.










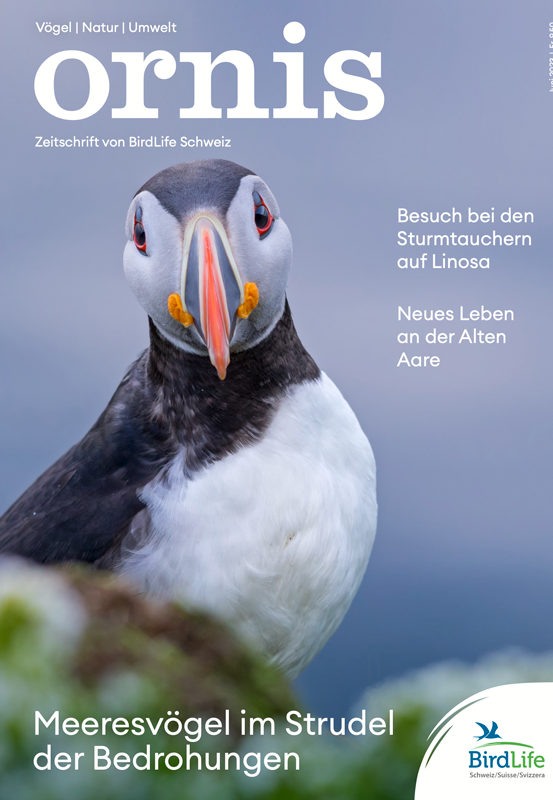
Obst und Biodiversität