Eindrücklich, sogar ein wenig unheimlich wirken seine feuerroten Augen – eine imposante Erscheinung. Der dunkle Bart und ein messerscharfer Schnabel lassen erahnen, wieso dem Bartgeier früher jede erdenkliche Gräueltat zugetraut wurde. Wer im 19. Jahrhundert naturkundlich gebildet war, wusste: Nicht nur Lämmer, selbst kleine Rinder, ab und zu gar Kinder fallen ins Beutespektrum dieses blutrünstigen Gyrs. Mit dem verbreiteten Aufkommen von Feuerwaffen und für damalige Zeiten respektablen Abschussprämien wurde deshalb der gefährliche «Lämmergeier» anfangs des 20. Jahrhunderts im Alpenraum schnell zum Verschwinden gebracht.
Doch der Bartgeier ist kein Jäger. Die Füsse sind kräftig, aber die Krallen stumpf und kaum geeignet, Tiere zu erlegen. Als hochspezialisierter Aasfresser hat der Bartgeier seine Nische in der Verwertung von Knochen gefunden. Mit besonders sauren Magensäften erschliesst er effizient die Nährstoffe, die in Knochen eingeschlossen sind. Dank einer Luftröhre, die fast bis zur Schnabelspitze führt, kann er auch atmen, wenn ein langer Knochen im Rachen steckt. Und allzu grosse Stücke zerkleinert er mit gezielten Abwürfen auf Felsen.
Die Erkenntnis, dass Bartgeier keine nimmersatten Beutegreifer sind, hat die Bestrebungen begünstigt, diesen faszinierenden Bergbewohner wieder in den Alpen anzusiedeln (siehe Ornis 3/00). In den 1970er-Jahren wurde ein internationales Zuchtprogramm gestartet. 1986 war der Zuchtstock soweit angewachsen, dass im österreichischen Nationalpark Hohe Tauern erstmals junge Bartgeier ausgewildert werden konnten. Seither wurden alpenweit jährlich bis zu zehn Bartgeier freigelassen.

Die jungen Bartgeier Kira, Ingenius und Sardona kurz nach der Auswilderung im Calfeisental 2010. Diese Tiere wurden speziell ausgewählt, um die genetische Basis der Wildpopulation zu verbessern. © Markus P. Stähli
Genetische Basis als Defizit
Zahlenmässig ist die Bilanz des Wiederansiedlungsprojekts beachtlich. Bisher wurden 179 junge Bartgeier ausgewildert. Im Jahr 1997 erfolgte die erste erfolgreiche Brut im Freiland. Seither sind über 80 Bartgeier in der freien Natur geboren. Der Gesamtbestand im Alpenraum dürfte sich heute auf rund 150 Vögel belaufen. Eine im Jahr 2008 veröffentlichte Studie zeigt ein sehr erfreuliches Bild. Sofern keine neuen Todesursachen die Sterblichkeit der Altvögel erhöhen, wird der Bestand auch ohne weiteres Zutun anwachsen.
Neben der rein numerischen Analyse müssen bei der Beurteilung des Wiederansiedlungsprojekts aber noch weitere Kriterien berücksichtigt werden. Defizite bestehen aktuell in der genetischen Basis der Wildpopulation. Um andere Bartgeierbestände nicht zu gefährden, wurde zu Beginn des Projektes entschieden, keine Wildfänge anzusiedeln. Stattdessen werden nur Tiere ausgewildert, die von Bartgeiern abstammen, die im Rahmen eines internationalen Zuchtprogramms in zahlreichen Zoos und Zuchtstationen gehalten werden.
Der Zuchtstock geht bislang auf lediglich 37 Bartgeier zurück. Diese Gründertiere bilden das genetische Potenzial der Wildpopulation. Einige dieser Tiere haben sich früh sehr erfolgreich fortgepflanzt. Andere zeugten erst spät oder nur unregelmässig Nachkommen. Um das wertvolle genetische Material im Zuchtstock nicht zu verlieren, mussten in einer ersten Phase von allen Gründertieren ausreichend Nachkommen zurückbehalten werden. So standen lange nur Bartgeier für die Auswilderung zur Verfügung, die von besonders «fortpflanzungsfreudigen» Gründertieren abstammten. Deshalb ging im Jahr 2007 noch über 50 Prozent der genetischen Information in der Wildpopulation auf nur sieben besonders erfolgreich brütende Gründertiere zurück.

Die drei Wildhüter Albert Good, Max Stacher und Rolf Wildhaber (von links) tragen am 11. Juni 2011 die drei jungen Bartgeier Scadella, Madagaskar und Tamina zur Auswilderungsnische im St. Gallischen Calfeisental. © Claudio Gotsch, engadin-foto.ch
Inzwischen ist der gesamte Zuchtstock beachtlich angewachsen. So kann jetzt mit gezielten Auswilderungen die genetische Basis der Wildpopulation entscheidend verbessert werden. Dazu werden in der Schweiz nur noch nach genetischen Kriterien ausgewählte Bartgeier freigesetzt. Gleichzeitig wird auf europäischer Ebene versucht, mit strategischen Auswilderungen in den Ausläufern der Südwest-Alpen eine Brücke zu den Bartgeiern in den Pyrenäen zu schlagen. Eine solche Verbindung ist ebenfalls ein wichtiger Schritt, die genetische Situation der Alpenpopulation nachhaltig zu verbessern. Wann und mit welchem Aufwand dies möglich wird, ist noch unklar.

Das Interesse am Bartgeierprojekt ist gross, wie dieser Mitarbeiter des Natur- und Tierparks Goldau zu spüren bekommt. Die Auswilderungen helfen mit, eine gute Basis für die Akzeptanz des Bartgeiers zu schaffen. © Markus P. Stähli
Vergiftungen vereiteln Ausbreitung
Bisher waren vor allem die Bartgeierauswilderungen in den Schweizer und schweiznahen Alpen erfolgreich. Hier haben bereits über 40 Prozent der ausgewilderten Bartgeier, die heute im geschlechtsreifen Alter sein müssten, erfolgreich gebrütet. Im Osten und Südwesten des Alpenbogens ist es dagegen bisher zu nur je zwei erfolgreichen Wildbruten gekommen. Die Ursachen hierfür müssen in den kommenden Jahren genau abgeklärt werden.
Leider ist die Situation für die Bartgeier im gesamten Mittelmeerraum wenig erfreulich. Die Pyrenäen-Population, die mit künstlich angelegten Futterplätzen gestützt wird, ist ausserhalb der Alpen die einzige noch vitale Bartgeierpopulation Europas. In Korsika und Kreta sind noch kleine, als äusserst kritisch zu beurteilende Restpopulationen vorhanden. Auch im Atlasgebirge ist die Situation schwierig, und im Balkan fehlen Bartgeier vollständig.
In Regionen, wo gewildert wird oder illegal Giftköder gegen Raubwild ausgelegt werden, ist eine Wiederansiedlung nur langfristig nach Schaffung der geeigneten Lebensgrundlagen möglich. Dies zeigt auch die jüngste Erfahrung aus Andalusien. Hier wurde 2006 ein neues Wiederansiedlungsprojekt gestartet. Trotz jahrelangen Anstrengungen, die Giftsituation zu entschärfen, sind bereits mehrere Bartgeier Vergiftungen zum Opfer gefallen. Giftköder gegen Raubwild und Reste von bleihaltiger Munition in der Nahrung haben zu diesen Ausfällen geführt. Die Auswilderungen wurden darum in diesem Jahr sistiert.
Bleivergiftungen können auch in den Alpen ein Problem darstellen. So wurden bei zwei Bartgeiern akute Bleivergiftungen festgestellt, die sie nur dank gelungenem Rückfang und sofortiger medizinischer Behandlung überlebten. Gefahr geht sowohl von Bleischrot als auch von bleihaltigen Geschossen aus, da diese im Wildkörper stark zersplittern. Verschiedene alternative Munition hat sich bereits in Praxistests bewährt. Es wird empfohlen, den Einsatz solcher Munition zu prüfen.
Der Bartgeier ist willkommen
In den vergangenen 20 Jahren hat die Stiftung Pro Bartgeier zusammen mit internationalen Partnern und der Vulture Conservation Foundation die notwendigen Strukturen und Methoden entwickelt, um die Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen professionell zu begleiten. Obwohl sich erste Erfolge abzeichnen, ist das Projekt noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Jahren muss die Bartgeierpopulation der Alpen bezüglich flächenmässiger Verbreitung, zahlenmässigem Bestand und insbesondere der genetischen Vielfalt gesichert werden. Gleichzeitig sollen Initiativen unterstützt werden, die die Situation für Bartgeier über den Alpenraum hinaus verbessern.
Aktuelle Erfahrungen aus dem Sarganserland, wo 2010 erstmals Bartgeier ausgewildert wurden, bestätigen, dass das Projekt in Wiederansiedlungsgebieten sehr positive Reaktionen auslöst und die Akzeptanz der Bartgeier bei der Bevölkerung gross ist. Mit der für 2013 geplanten Verlagerung des Projekts in die Zentralschweiz soll auch in dieser Region eine starke Identifikation mit dem Bartgeier als Symbol für eine intakte Bergwelt geschaffen werden.
Diese positive Wahrnehmung des Bartgeiers ist eine wichtige Voraussetzung im Umgang mit zukünftigen Gefahren. So ist beispielsweise noch ungenügend geklärt, inwiefern grosse Windkraftanlagen in Bergregionen eine Gefahr für den Bartgeier darstellen. Da bereits eine geringe Erhöhung der Mortalität über das Fortbestehen der Bartgeierpopulation in den Alpen entscheidet, gilt es sehr vorsichtig zu agieren und die nötigen Massnahmen zu treffen, um keine neuen Gefahrenquellen zu schaffen.
Ziel aller Bemühungen ist es, im Alpenraum einen vitalen, sich selbst erhaltenden Bartgeierbestand anzusiedeln. Dazu haben wir in der Schweiz die besten Voraussetzungen: Die Wildtierbestände sind gut und Vergiftungen und Wilderei sind nur selten ein Problem. So sind wir optimistisch, in einigen Jahren die letzte Bartgeierauswilderung feiern zu können. Bis dahin hoffen wir weiterhin auf breite Unterstützung, damit der Bartgeier bald wieder als fester Bestandteil unserer Bergwelt leben kann.
Dr. Daniel Hegglin arbeitet bei der Forschungs- und Beratungsgemeinschaft SWILD und ist Geschäftsführer der Stiftung Pro Bartgeier. Dr. Jürg Paul Müller ist Zoologe, Mitbegründer des Projektes zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Schweizer Alpen und Präsident der Stiftung Pro Bartgeier.
Robin K., Müller J.P., Pachlatko T. (2003): Der Bartgeier. Robin Habitat AG, Uznach, 224 Seiten.
Die Bartgeier unterstützen
Die genaue Überwachung des Bartgeierbestands ist ein wichtiges Instrument für die Erfolgskontrolle des Wiederansiedlungsprojekts. Sie erlaubt auch, allfällige Probleme frühzeitig zu erkennen. Die Stiftung Pro Bartgeier ruft deshalb dazu auf, Beobachtungen von Bartgeiern über die Internetseite www.ornitho.ch zu melden (für nicht registrierte Benutzer auf www.bartgeier.ch). Anfangs Oktober (Stichtag 8.10.2011) finden zum 6. Mal die Internationalen Bartgeierzähltage statt. Informationen dazu werden auf www.bartgeier.ch publiziert. Die Stiftung Pro Bartgeier freut sich weiterhin über jede Spende zugunsten des Bartgeiers:
www.bartgeier.ch/spenden.











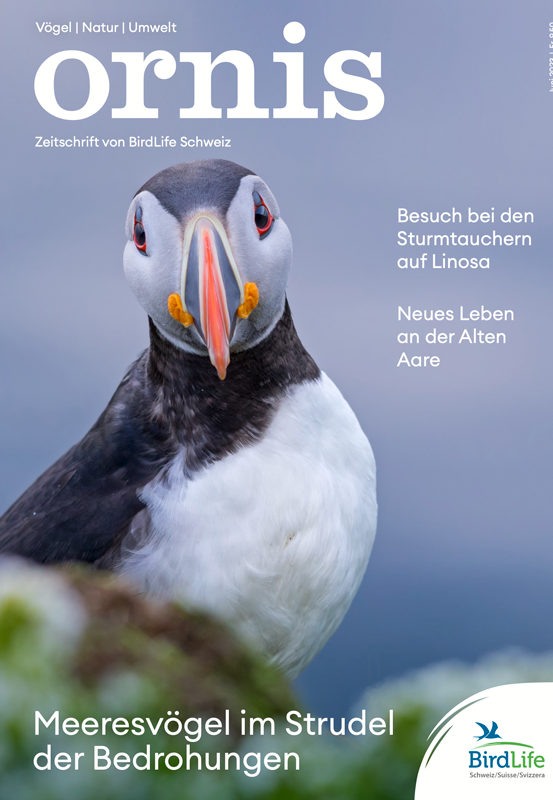
Der lange Weg zurück