Als Beatrice Miranda frühmorgens in ihren Spechtwald eintritt, verschleiern noch Nebelschwaden die Sicht. Es ist seltsam ruhig, silbern ragen tausende Stämme in den Himmel. Die Forscherin nimmt den Feldstecher in die Hand, schaut sich um und horcht. War das eben ein «kix»-Ruf eines Buntspechts? Klopft da einer an einen morschen Ast? Flog da nicht eben einer im typischen Wellenflug von Baum zu Baum? «Mit der Zeit entwickelt man ein gutes Suchbild für die Spechte», sagt sie. «Man weiss genau, wie sich die Vögel am Baum fortbewegen und wo sie sich mit Vorliebe verstecken.» Doch heute bleibt es ruhig im Niderholz bei Marthalen, Kanton Zürich. Kein Vogel, mindestens eine halbe Stunde lang.
Beatrice Miranda ist schon lange fasziniert von Dendrocopos major, dem Buntspecht. Sie hatte 2006 ihre Doktorarbeit über den amselgrossen Vogel geschrieben. Noch heute sucht sie im Niderholz jedes Jahr die Bruthöhlen und beobachtet «ihre» Spechte auch im Winter. «Um Weihnachten ist oft besonders viel los», sagt sie. «Die Buntspechte beginnen bereits zu trommeln und ihre Reviere zu verteidigen.»
Das Niderholz besteht zu grossen Teilen aus Eichen-Hagebuchenwald mit eingesprengten Föhren – idealem Lebensraum für den Buntspecht. Besonders wertvoll ist der hohe Anteil an alten Bäumen mit abgestorbenen Ästen und morschen Stellen, wie Beatrice Miranda in ihrer Forschungsarbeit klar gesehen hat. «Je mehr solche Bäume, umso grösser ist die Buntspecht-Dichte», sagt sie.
Kampf der Trommler
Dann endlich ein Trommelwirbel. Der gefiederte Perkussionist sitzt weit oben in einer Eiche. Von links fliegt ein zweiter Specht heran, man hört aggressive «kix»-Rufe, dann ein lautstarkes Zetern. Die Sonne sendet erste Strahlen durch den Nebel, die Spechte erwachen zum Leben.
«An den Buntspechten gefällt mir, dass sie sich so leicht aufregen», sagt Beatrice Miranda. «Es braucht nur wenig, und schon sträuben sie ihre Federn und rufen aus. Danach können sie mit Schimpfen fast nicht mehr aufhören.» In der Tat gelten Buntspechte als eher aufbrausende Zeitgenossen. Die Männchen verteidigen das ganze Jahr über ihre Reviere. Kommt ein anderer Specht in die Nähe oder inspiziert er gar eine Höhle, kommt es zu Zank und Verfolgungsjagden.
Die Weibchen setzen derweil andere Prioritäten: Sie verteidigen im Winter keine eigenen Reviere, sondern buhlen um die Männchen. «Sie fliegen durch den Wald und inspizieren die Reviere der Männchen», sagt Klaus Michalek, ein österreichischer Ornithologe, der seit 1993 den Buntspecht erforscht. «Zuerst werden sie von den Männchen vertrieben, aber irgendwann so um Ende Februar dürfen sie in einem Revier bleiben.»
Ab dem Zeitpunkt nimmt die Aggressivität zwischen den Partnern ab – doch auch noch später in der Brutzeit sieht man die beiden nur selten in trauter Eintracht nebeneinander sitzen. Lieber bleiben sie etwas auf Distanz – ausser wenn sie sich gerade paaren.
Statt auf Gesang setzen die Spechte auf Trommelwirbel. Damit zeigen sie den Anspruch auf ein Revier und locken gleichzeitig das andere Geschlecht an. Als Resonanzkörper dienen dürre Äste oder Stämme oben in der Krone, aber auch mal Stahlmasten oder Bleche.
Ein Wirbel ist etwa eine halbe Sekunde lang und damit deutlich kürzer als die Trommelsequenzen anderer Spechtarten. Nicht zu verwechseln ist das Trommeln mit dem häufig zu hörenden Hacken. Dieses dient «bloss» der Nahrungssuche.
Der Buntspecht ist optimal an das Klettern am Baum angepasst. Das Männchen (erstes Bild) unterscheidet sich vom Weibchen (zweites Bild) durch den roten Nacken. © Peter Cairns/rspb-images.com
Hacken und schmieden
«Buntspechte sind in der kalten Jahreszeit vor allem Hackspechte», sagt Beatrice Miranda, als sie vor einem halb zersetzten Spechtbaum steht. Insbesondere hauen die Spechte Käfer- und andere Larven aus dem morschen Holz, wobei sie die Beute wie mit einer Harpune aufspiessen können – dank Borstenhaken an der verstärkten Zungenspitze.
Eine weitere Nahrungssuchtechnik, das sogenannte Schmieden, kommt im Winter ebenfalls häufig zum Einsatz. Die Technik beweist, wie intelligent die Spechte sind: Das Schmieden gilt nämlich als Vorstufe des Werkzeuggebrauchs, was nur wenige Tierarten beherrschen. Spechte haben denn auch ein aussergewöhnlich grosses Gehirn, vergleichbar mit jenem der Krähenvögel.
Beim Schmieden klemmen die Buntspechte Fichten- oder Föhrenzapfen oder Nüsse in eine Rindenspalte, die sie teilweise selber gezimmert oder verbessert haben. Danach können sie die Zapfen oder Nüsse aufhacken. Nur so kommen sie an die fetthaltigen Samen – im Winter ein entscheidender Vorteil, wenn die tierische Nahrung schwindet. Ist bereits ein alter Zapfen eingeklemmt, drückt der Specht den neuen Zapfen mit der Brust gegen den Baum, während er den alten entfernt. Er kann bis zu 30 Gramm schwere Zapfen herantragen, was fast seinem halben Körpergewicht entspricht. Rund vier Zapfen benötigen die Spechte pro Tag.
Selbstredend, ist Dendrocopos major optimal an das Klettern am Baum angepasst. Die Vögel verfügen über kurze kräftige Beine und Kletterfüsse mit vier Zehen. Zwei Zehen sind nach vorne gerichtet, zwei nach hinten. Während eine hintere Zehe sehr beweglich ist, werden die anderen drei Zehen durch eine gemeinsame Sehne gegeneinander gezogen, was einen optimalen Halt verspricht. Gleichzeitig nutzen die Spechte die nadelspitzen Krallen wie Steigeisen. Für ein optimales Gleichgewicht hilft zudem der Stützschwanz aus besonders harten Federn. Dieser bleibt auch während der fast sechsmonatigen Mauser stets voll funktionsfähig, indem die Federn in einer strengen Abfolge nacheinander ersetzt werden.
Die Meinung, der Buntspecht könne nur mit dem Kopf nach oben klettern, ist übrigens nicht ganz richtig: Zwar hüpft der Vogel am Stamm nur im Rückwärtsgang nach unten. In der Höhle aber kann er sich auch kopfvoran nach unten hangeln.
Typisch ist schliesslich der kräftige Meisselschnabel, der neben dem Hacken und Trommeln auch für den Bau von Höhlen eingesetzt wird. Dabei muss der Körper Schläge in der Stärke der 1200-fachen Erdbeschleunigung abfedern. Das entspricht einem Aufprall eines Velofahrers mit 25 km/h gegen eine Wand.
Als Rezept gegen Kopf- oder andere Schmerzen haben Spechte diverse Anpassungen entwickelt. Schnabelbasis und Kopf sind federnd miteinander verbunden; dazwischen liegt eine schwammartige Knorpelschicht, die als Stossdämpfer dient. Die Schädeldecke ist besonders stabil und dick, um das Gehirn zu schützen. Ebenso ist die äussere Hirnhaut sehr zäh. Die Augen sind sehr gut in den Augenhöhlen befestigt. Weitere spezielle Verstärkungen sind im Bereich der Rippen und der ausgeprägten Kiefer- und Nackenmuskeln zu finden.
Der Bau einer Höhle dauert zwei bis drei Wochen. Die Bauphasen wechseln sich mit längeren Pausen ab. Zweites Bild: Längsschnitt durch eine Buntspechthöhle. © Alain Saunier, Frank Hecker
Schluckspechte der anderen Art
Beatrice Miranda zeigt jetzt auf eine Linde, die eigentümliche horizontale Linien aus Löchern aufweist. «Im Frühling werden die Buntspechte zu Schluckspechten», sagt sie und lacht. Gerne betätigen sich die findigen Vögel nämlich im sogenannten «Ringeln». Dabei schlagen sie in waagrechten Linien zahlreiche Löcher in einen Baum, worauf zuckerhaltiger Baumsaft austritt. Dieser kann dann getrunken werden und ist auch von anderen Arten wie Meisen, Eichhörnchen oder Hirschen heiss begehrt.
Im Frühsommer fressen sich die Spechte dann auch an den unzähligen Raupen und anderen Gliedertieren satt, die auf den Bäumen herumwuseln. Auch Beeren und Früchte verschmähen sie nicht. Und sie betätigen sich immer wieder als Nesträuber. Manch aufgehackter Meisenkasten zeugt davon...
Wieder keifen zwei Buntspechte hoch über dem Weg, während Beatrice Miranda immer weiter in das Niderholz eindringt. Bald steht sie in einem Waldreservat mit besonders prächtigen alten Eichen. Sie zeigt auf eine frisch gebaute Höhle auf rund acht Metern Höhe, gut geschützt unter einem grossen Baumpilz. «Das ist ein typischer Standort für eine Spechthöhle. Wo Baumpilze spriessen, ist das Holz meist zersetzt und weich.»
Die Buntspechte bauen in ihrem Leben mehrere Höhlen, die sie als Schlaf- und Bruthöhlen nutzen. Der Bau einer solchen Unterkunft dauert zwei bis drei Wochen. Dabei werden die Höhlen meistens in morsches Holz gehackt. Doch die gefiederten Zimmerleute können auch über Jahre hinaus «planen»: Indem sie zuerst nur ein relativ kleines Loch in das Holz hacken, können dort Pilze eindringen. Nach einigen Jahren ist das Holz zersetzt, und der Specht vollendet das Bauwerk.
Die Spechthöhlen sind auch für andere Arten sehr wertvoll. Wo sonst könnten Stare, Meisen, Kleiber oder Trauerschnäpper, aber auch Hornissen, Siebenschläfer oder Fledermäuse ihr Quartier errichten? In den Bergwäldern ist auch der Sperlingskauz auf die Höhlen des Buntspechts angewiesen: Er nutzt sie nicht nur als Nistplatz, sondern auch als Zwischenlager für tote Mäuse.
Männchen investieren mehr in die Brutpflege
Interessanterweise wird die Bruthöhle des Buntspechts fast nur vom Männchen gebaut. Auch die Bewachung des Brutstandorts ist zu über 70 Prozent seine Sache. Zudem sind es die Männchen, die sich nachts um das Gelege und die Nestlinge kümmern – die Weibchen halten sich in der Nacht nie in der Bruthöhle auf. Die restlichen Aufgaben rund um den Nachwuchs teilen sich die beiden Eltern auf. «Insgesamt investieren die Männchen somit deutlich mehr in die Brutpflege als die Weibchen», sagt Klaus Michalek, der die Rolle der Geschlechter beim Buntspecht über Jahre untersucht hat.
Und genau diese partielle Rollenumkehr erklärt auch andere spezielle Verhaltensweisen, die erst in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind. Einerseits ist sie ein Grund dafür, dass die Weibchen im Frühling um die begehrten Männchen buhlen und nicht umgekehrt. Andererseits erklärt sie, warum beim Buntspecht auch schon Polyandrie beobachtet wurde – was bedeutet, dass ein Weibchen mit zwei Männchen verpaart ist. Somit kann das Weibchen fast gleichzeitig zwei Bruten aufziehen und auf die Dienste von zwei Männchen zählen.
Schliesslich erklärt der hohe Einsatz der Männchen auch, weshalb bei den Buntspechten kaum Fremdvaterschaften vorkommen. «Für das Männchen würde sich die hohe Investition in die Jungen nicht auszahlen, wenn es sich nicht sicher um seine Sprösslinge handeln würde», so Klaus Michalek. Der Forscher hatte 166 Buntspecht-Küken auf ihre Gene untersucht. Der Aufwand war enorm: Er musste zahlreiche Höhlen suchen, zu ihnen emporklettern und die Küken mit einer Schlinge aus Silch herausziehen. Dann nahm er den Jungen etwas Blut, beringte sie mit Farbringen und legte sie wieder in das Nest. Nach der DNA-Analyse zeigte sich: Nur gerade zwei der insgesamt 166 Küken waren von fremden Vätern. Das ist sehr wenig im Vergleich zu den Singvögeln, bei denen oft mehr als die Hälfte der Jungen «Kuckuckskinder» sind.
Die Brutbiologie der Buntspechte ist aber auch sonst erstaunlich. So liegt die Brutdauer gerade mal bei 8,5 bis 10 Tagen – das ist unter allen Vögeln Rekord. Ein Grund dafür ist vermutlich, dass in der Bruthöhle oft Sauerstoffmangel herrscht. Die Embryos in den Eiern benötigen aber für ihr Wachstum viel Sauerstoff. Könnten sie nicht sehr früh ausschlüpfen und mit ihren Lungen richtig zu atmen beginnen, würde ihnen der tiefe Sauerstoffgehalt zum Verhängnis werden.
Die fünf bis sieben Küken sind nach dem Schlüpfen völlig unbefiedert und hilflos. Die Augen sind noch nicht geöffnet und liegen unter einer papierdünnen Haut. Auch die Ohren sind noch verschlossen. Dicht aneinander geschmiegt liegen die Neugeborenen auf dem Höhlenboden und stapeln ihre Köpfe aufeinander. So können sie einander etwas wärmen. Reflexartig öffnen sie ihren noch kurzen, dafür umso breiteren Schnabel, sobald ihre Eltern mit Futter eintreffen. Innen ist der Rachen weiss gefärbt, damit die Eltern ihn auch im Dunkeln sehen können.
Die Nestlinge wachsen sehr schnell und fliegen nach rund drei Wochen aus. Sie werden danach nur noch etwa zehn Tage weitergefüttert (zweites Bild). © Rolf Kunz, blickwinkel/J. Fieber
Laute und gefrässige Grünschnäbel
Die Fütterungszeit ist optimal auf die wenigen Wochen im Jahr ausgelegt, in denen es im Wald von Raupen und anderen Insekten nur so wimmelt. So sind die Jungen nach fünf Tagen bereits viermal schwerer als nach dem Schlüpfen und wiegen nun 20 Gramm. Sie machen sich immer stärker bemerkbar – und bald hört man schon aus vielen Metern Distanz zum Brutbaum ein stetes Wispern, die sogenannte «Zirpwache». Damit sollen wohl die Eltern dazu animiert werden, möglichst oft mit Nahrung herbeizufliegen. Gleichzeitig lockt das Gefiepe aber auch Beutegreifer wie den Siebenschläfer an. Allerdings sind die Nestlinge in ihren Höhlen recht gut vor Angreifern geschützt, sonst wäre ihnen das laute Zirpen im Lauf der Evolution wohl schon lange vergangen.
Nach drei Wochen sind die Jungvögel beinahe ausgewachsen, und die Altvögel locken sie aus der Höhle, indem sie die Fütterungen immer mehr einstellen. Vom Hunger getrieben, verlassen die zunehmend aggressiven «Teenager» die Höhle und machen erste Flugerfahrungen. Nun teilt sich die Familie auf. Die einen Jungen werden von der Mutter geführt, die anderen vom Vater. Doch der Support ist kurz: Schon nach zehn Tagen sind die Jungen ganz auf sich selbst gestellt. Auch das ist speziell: Bei anderen Spechten wie dem Schwarz-, Grün- oder Dreizehenspecht dauert die Zeit der Jungenführung zwei Monate...
Das Glück liegt in der Ferne
Nicht ungewöhnlich ist die eher geringe Überlebensrate: Nur ein bis vier Junge pro Brutpaar leben nach den ersten Wochen noch. Sie streifen umher und versuchen sich irgendwo anzusiedeln. Dabei können sie Strecken von mehreren hundert Kilometern zurücklegen.
Die Rückkehrrate an den Ort der Geburt ist sehr gering. Von 180 Jungvögeln, die Klaus Michalek in einem Wald bei Wien beringt hatte, kehrten im Jahr darauf nur gerade 11 in den Wald zurück. Anscheinend versuchen die Jungspechte ihr Glück lieber anderswo – was durchaus Sinn macht, um Inzucht zu vermeiden.
Einmal angesiedelt, bleiben sie einem Gebiet allerdings sehr treu. Selbstredend herrscht das grösste Gerangel um die besonders guten Habitate – die Eichen- oder Buchen-Mischwälder mit vielen alten Bäumen, viel stehendem Totholz und entsprechend viel Nahrung. In solchen Lebensräumen sind die Reviere gerade mal drei Hektaren gross, während sie an weniger geeigneten Orten – etwa in den Bergen – bis zu 30-mal grösser sind.
Es ist kurz vor Mittag. Beatrice Miranda hat genug gesehen von «ihren» Spechten. Sie fährt zurück in die Zivilisation. Als sie im Hauptbahnhof Zürich umsteigen will, hört sie es schon wieder, das vertraute «kix». Der rufende Buntspecht sitzt auf einem hohen Baum im nahen Park. «Das ist der Beweis, dass Buntspechte nicht nur Waldbewohner, sondern auch waschechte Kulturfolger sind», sagt sie und lacht. «Wer alte Bäume und Totholz fördert, wird deshalb auch den Buntspecht fördern. Im Wald, im Dorf oder mitten in der Grossstadt.»
Stefan Bachmann ist Biologe und Redaktor von Ornis. Er hat seine Diplomarbeit zur Raumnutzung von Bunt- und Mittelspecht geschrieben und insgesamt 23 Spechte telemetriert.
Grosses Verbreitungsgebiet
Der Buntspecht besiedelt fast den ganzen Laub- und Nadelwaldgürtel Europas und Asiens, inklusive weiter Teile Chinas, Koreas und Japans. Er kommt zudem in Marokko, Algerien und Tunesien vor. In Irland brütet er erst seit wenigen Jahren. Es werden insgesamt 14 Unterarten unterschieden.
Die bei uns vorkommende Unterart pinetorum ist ein Standvogel. Hingegen kommt es bei der nördlichen Unterart major im Winter regelmässig zu grossen Zugbewegungen in Richtung Süden. Dies geschieht bei einem zu geringen Angebot an Koniferensamen in den Taigawäldern.
In der Schweiz ist der Buntspecht mit 40 000 bis 60 000 Brutpaaren häufig. Der Bestand ist laut Vogelwarte Sempach nach einem Anstieg ab den Neunzigerjahren seit 2005 ungefähr stabil.
Alte Bäume braucht das Land
Der Buntspecht ist wie die anderen Spechtarten auf alte Bäume und Totholz angewiesen. Doch in zwei Dritteln unserer Landschaft drohen grosse, einheimische Bäume zu verschwinden. Damit es dem Buntspecht nicht ergeht wie anderen einstmals häufigen Vogelarten, die heute auf der Roten Liste stehen, fordert BirdLife Schweiz:
■ Erhaltung und Förderung von alten Bäumen im Siedlungsraum
In neuen Quartieren in Städten und Agglomerationen gibt es fast keine grösseren einheimischen Bäume mehr. Bei Neubauten werden alte Bäume gefällt. Nötig ist daher ein besserer Baumschutz. Andererseits müssen Ausnützungsziffern und die Unterbauung von Parzellen mit Garagen so gestaltet werden, dass Räume für grosse, einheimische Bäume freigehalten werden. Ganz wichtig für die Biodiversität ist, dass wieder vermehrt einheimische Bäume gesetzt werden und weniger Exoten.
■ Mehr Feldbäume und Alleen im Kulturland
In vielen Kulturlandflächen gibt es keine Feldbäume oder kleine Gehölze mehr. Diese sind nicht nur für den Buntspecht wichtig, sondern bieten auch einer Vielzahl anderer Arten Lebensraum. Auch Alleen sind wichtige Vernetzungselemente und Lebensräume.
■ Biotopbäume im Wald fördern
Ein Teil der Waldbesitzer und Förster geht bereits mit gutem Beispiel voran und lässt alte und dicke Bäume als sogenannte Biotopbäume stehen. Es braucht jedoch noch viel mehr Biotopbäume, da die meisten Waldbäume schon nach einem Drittel ihres möglichen Alters gefällt werden.













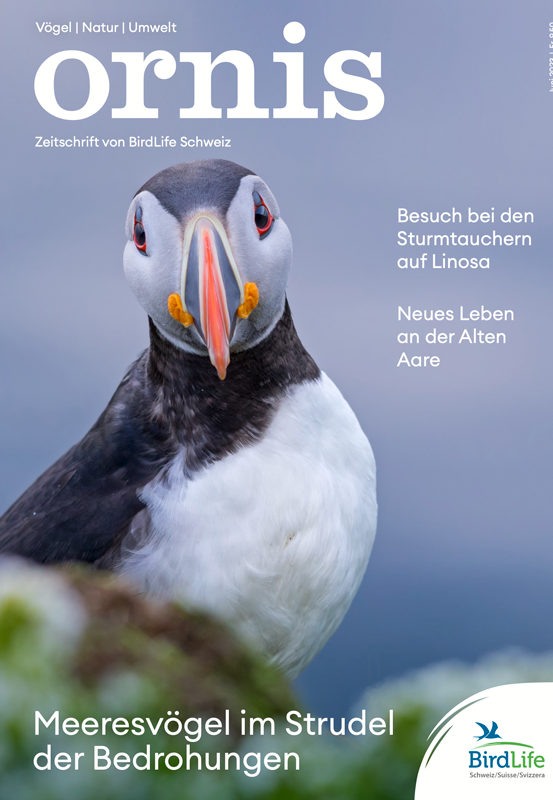
Der bunte Zimmermann