Ein Blick in den Historischen Brutvogelatlas zeigt, dass die Grauammer noch in den 1970er-Jahren in grossen Teilen des Mittellandes vorkam – und zwar vielerorts in guten Beständen. Allein im Zürcher Unterland zählte der Geschäftsführer des SVS 1975 beispielsweise 48 Reviere. Auch etliche Alpentäler und das Tessin waren noch von der unscheinbaren Art mit dem charakteristischen Gesang besiedelt. Im Vergleich dazu zeigte der zweite Brutvogelatlas aus den 1990er-Jahren bereits grosse Lücken im Deutschschweizer Mittelland, und die Vorkommen in den Alpentälern und im Tessin waren ganz erloschen. Einige neu besiedelte Atlasquadrate, so im Mittelwallis, in der Westschweiz und im Kanton Schaffhausen, änderten an der stark negativen Bilanz nicht viel.
Nun wurden die Schweizer Vorkommen der Art erneut untersucht. Die Ergebnisse der Kartierung von 2009 bis 2011 sind in einer Publikation zusammengefasst, die im Dezember 2013 im Ornithologischen Beobachter publiziert wurde. Analysiert wurden die Daten von SVS/BirdLife Schweiz, der Schweizerischen Vogelwarte und von weiteren Partnern. Die Resultate sind alarmierend: Im Vergleich zu den 1990er-Jahren musste die Grauammer nochmals starke Verluste hinnehmen. Insbesondere das St. Galler Rheintal, das Mittelwallis und die Aareebene BE/SO sind heute ebenfalls geräumt oder nur noch sporadisch besiedelt. Auch die einst wichtige Population im Reusstal AG/ZG ist erloschen.
Entsprechend nahm auch die Anzahl Brutpaare weiter ab. Heute leben nur noch etwa 100 Paare in der Schweiz. 1993 bis 1996 waren es noch schätzungsweise 500 Paare. Dies entspricht einem Rückgang um 80 Prozent in weniger als 20 Jahren.
Keine präzisen Bestandsschätzungen bestehen aus den 1950er- und 1970er-Jahren. Damals könnten aber noch über 1000 Paare in der Schweiz gebrütet haben, da die Brutgebiete noch mehr als doppelt so gross waren wie in den 1990er-Jahren. Eine solche Schätzung ist allerdings mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
Internationaler Trend
Nicht nur in der Schweiz geht es der Grauammer schlecht. Besonders markant ist der Rückgang im Norden des Verbreitungsgebiets. So ist die Art in Norwegen, aber auch in Irland bereits ausgestorben. Im Fall von Irland ist eine dramatische Verarmung der genetischen Vielfalt zu konstatieren, weil dort die Unterart clanceyi vorkam, die sonst nur noch die Äusseren Hebriden besiedelt.
In Frankreich nahm die Art von 1989 bis 2012 um 38 Prozent ab. Immerhin ist seit 2001 eine Stabilisierung zu beobachten. Auch in Baden-Württemberg und Bayern verringerten sich die Bestände zwischen 1980 und 2005 um mehr als die Hälfte.
Die Gründe für den Rückgang liegen in der fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft. Die Mechanismen sind jedoch ungenügend bekannt. Die Umwandlung traditioneller Höfe mit gemischter Acker- und Viehwirtschaft in spezialisierte Betriebe, die Abnahme des Gerstenanbaus sowie die Zunahme von Winter- statt Sommergetreide sind wohl einige der Faktoren, die der Ammer zusetzen.
Glücklicherweise gibt es auch Lichtblicke. Europaweit profitierte die Grauammer von den Brachflächen, welche die Europäische Union vorübergehend vorschrieb. Nach 2007 wurde diese Politik allerdings wieder aufgegeben, um die Energieproduktion auf Basis von Biomasse zu forcieren. In der Schweiz gelang es zumindest im Grossen Moos, die Population zu stabilisieren, indem das Kulturland mit Buntbrachen, Hecken und Feuchtstandorten aufgewertet wurde. Auch in der Champagne genevoise und im Klettgau SH profitierte die Grauammer von Aufwertungen. Diese wurden von der Vogelwarte Sempach zugunsten des Rebhuhns durchgeführt. Weiter wird die letzte grosse Wiesenpopulation, jene auf dem Gelände des Flughafens Zürich-Kloten, seit Jahren vom SVS und vom ZVS/BirdLife Zürich verfolgt.

Im Grossen Moos profitiert die Grauammer von Aufwertungen wie etwa Buntbrachen. © Stefan Bachmann
Vor allem Buntbrachen sind für die Grauammer entscheidend, aber auch sogenannte Rückzugsstreifen, welche weitgehend Buntbrachen entsprechen, darüber hinaus aber speziell gepflegt werden. Am wertvollsten erwiesen sich aber Buntbrachen in Kombination mit Rotationsbrachen oder extensivem Grünland von hoher ökologischer Qualität. Niederhecken, Buschgruppen oder Einzelbäume ergänzen das Idealhabitat.
Buntbrachen verschwinden wieder
Heute machen Buntbrachen weniger als 0,5 Prozent der Ackerfläche und nur etwa 0,2 Prozent der gesamten Landwirtschaftsfläche aus. Um die Grauammer erfolgreich zu fördern, sollten aber Buntbrachen und andere Biodiversitätsförderflächen mindestens 5 Prozent ausmachen. Das ist keine grosse Zahl – die Förderung des Vogels sollte also zumindest in Kerngebieten machbar sein.
Für den langfristigen Erhalt braucht es allerdings substanzielle Verbesserungen in der Agrarpolitik. Denn einer der unverständlichen Aspekte der Agrarpolitik 2014-2017 ist es, dass für Buntbrachen und Säume auf Ackerland auch in Zukunft zuwenig Anreize bestehen (siehe auch Seite 38).
Trotzdem darf mit der Förderung der Grauammer nicht zugewartet werden. Dringend Unterstützung brauchen insbesondere die letzten grösseren Populationen. Weitere Gebiete mit Potenzial sind bereits identifiziert: so das Landwirtschaftsgebiet rund um den Flughafen Zürich-Kloten sowie die Region zwischen Murten-, Neuenburger- und Genfersee. In diesen Gebieten soll die Förderung der Grauammer im Rahmen des Artenförderungsprogramms des SVS/BirdLife Schweiz und der Vogelwarte Sempach vorangetrieben werden.
Raffael Ayé ist Projektleiter Artenförderung beim SVS/BirdLife Schweiz.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter www.birdlife.ch/grauammer. Auf dieser Webseite kann auch die Publikation des Ornithologischen Beobachters heruntergeladen werden.
Die Grauammer, ein Steppenvogel
Die Grauammer hat ihren Verbreitungsschwerpunkt im Mittelmeerraum, vom Maghreb über Südeuropa bis in die Türkei. Die Art besiedelt aber auch viele andere Gebiete Europas mit Ausnahme des Nordens. In Zentralasien brütet sie ebenfalls in einem kleineren Verbreitungsgebiet.
Ursprünglich besiedelt die Ammernart vor allem steppenartige Landschaften. In weiten Teilen Europas bieten jedoch heute Äcker einen sekundären Lebensraum. Auch in Feuchtwiesen kommt die Art vor. Nicht immer ist klar, woran es der Art genau fehlt – denn manchernorts ist sie verschwunden, obwohl scheinbar noch geeignete Lebensräume vorhanden wären.







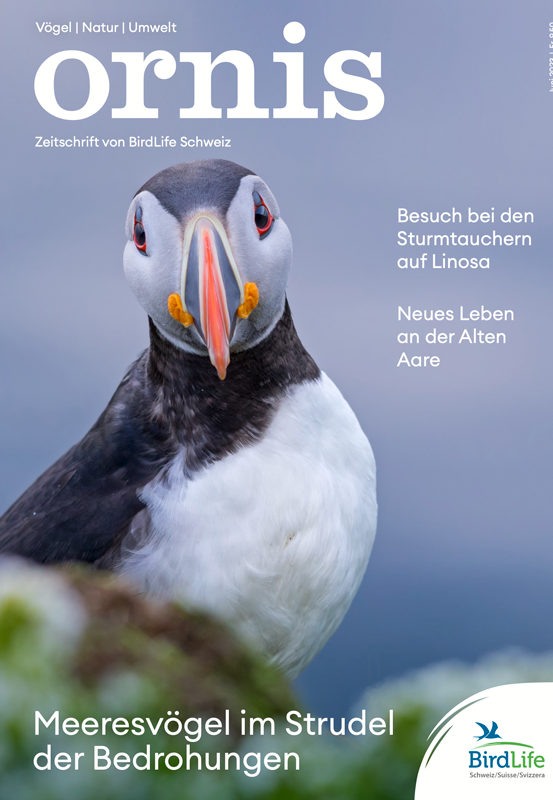
Bunte Brachen für graue Ammern